  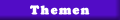
Die Ameise als Tramp
Von biologischen Invasionen
Monikas Meinung:
   
Der Mensch hat seit jeher die Angewohnheit, auf
seinen Wanderungen und Reisen das mitzunehmen, was ihm am liebsten ist, u. a. auch seine
Haustiere und Nutzpflanzen. So ist es nicht verwunderlich, dass im Kielwasser der
menschlichen Siedler Tiere und Pflanzen in Ökosysteme gelangten, in denen sie oft völlig
fehl am Platze waren. Das traurige Beispiel der Kaninchenplage in Australien ist den
meisten von uns bekannt, aber von diesen Extremfällen einmal abgesehen ist den wenigsten
bewusst, wie viel von der Flora und Fauna, die sie umgibt, eigentlich gar nicht in dem
jeweiligen Lebensraum heimisch ist.
Bernhard Kegel zieht in seinem Buch Bilanz über die Folgen, die solche
Eingriffe in die Natur haben können, die oft noch nicht einmal beabsichtigt sind oder
sogar in bester Absicht gemacht werden. Da das Thema bei weitem zu umfangreich ist, um auf
300 Seiten abgehandelt zu werden, beschränkt der Autor sich auf einige markante
Beispiele, darunter die Auswirkungen, die die Ankunft der europäischen Siedler auf die
Inselwelt Neuseelands hatte.
Das Buch beginnt mit einem Ausflug in die Erdgeschichte und reißt kurz
die augenblickliche Situation im "Großstadtdschungel" an. Darauf folgt eine
ausführlichere Beschreibung von verschiedenen "Invasionen": neue Säugetiere in
Europa, der Weg verschiedener Lebewesen durch den Suezkanal, die sog. "Lessepsche
Migration", die Tramp-Ameisen und andere Insekten. Die Folgen solcher Invasionen sind
mancherorts dramatisch. Auch wenn die Fischer am Viktoriasee sich über die riesigen
Nilbarsche freuen, die in ihren Netzen zappeln, so haben diese nichtsdestotrotz dazu
geführt, dass dieser einzigartige See inzwischen ein trostloses Gewässer geworden ist.
Dort, wo man einst die Evolution anhand der vielen Arten von Viktoriabarschen sozusagen
vor Ort verfolgen konnte, gibt es heute nicht mehr viel zu erforschen; die Fischindustrie
hat durch die Aussetzung von Nilbarschen gründlich aufgeräumt mit den endemischen Arten,
die als Trash Fish galten, weil sie den Fischern zu klein waren.
Die sterbenden Wälder von Guam sind ein anderes Beispiel, hier sind es
die Vögel, die fast von heute auf morgen verschwunden sind, die Liste ließe sich
beliebig fortsetzen. Die Mechanismen, denen das Eindringen fremder Floren und Faunen
unterliegt, werden im folgenden Kapitel erklärt. Nicht alle Organismen eignen sich als
Invasoren, die meisten scheitern von vornherein, und nur einer von zehn wird schließlich
zum Schädling. Man kann nie vorher sagen, wer gewinnt und wer letztendlich verliert, und
bekanntlich können auch Einheimische zum Ärgernis werden.
Ob die Natur irgendwann den Menschen brauchen wird, um zu bestehen, ist
noch nicht geklärt. Da sie sich im Verlauf der Erdgeschichte aber immer wieder von
großen Katastrophen erholt hat, auch wenn es manchmal sehr lange gedauert hat - jedenfalls
in menschlichen Maßstäben gerechnet - wird sie sicher auch unsere Spezies überleben.
Dass danach vielleicht alles anders sein wird, steht auf einem anderen Blatt. Aber sagte
nicht schon Stephen Jay Gould, dass die Evolution von unvorhersehbaren Zufällen bestimmt
sei und keineswegs auf ein bestimmtes "höheres" Ziel zusteuere, wie viele sich
das in ihrem Anthropozentrismus gern vorstellen? Die Erde braucht den Menschen nicht, aber
der Mensch braucht die Erde, darüber sollte man sich klar werden. Wenn Bernhard Kegels
Buch dazu beiträgt, dass wir alle ein wenig bewusster mit unserer Umwelt umgehen, dann
hat es sein Ziel erreicht. Jeder sollte anfangen, darüber nachzudenken,
wie er seinen bescheidenen Beitrag leisten kann, es ist im Grunde so einfach. Und es ist
niemals zu spät, um damit anzufangen.
Erschienen im Ammann Verlag Zürich 1999
ISBN 3-250-10404-3
|